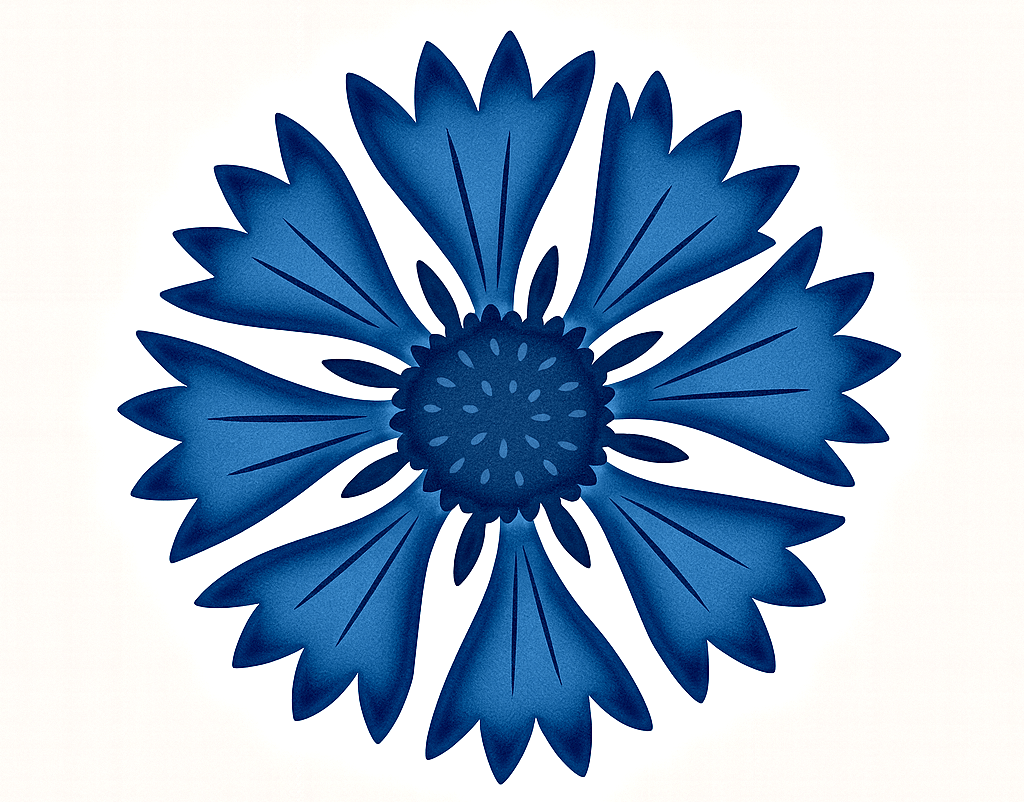Marcel Fratzscher, linksgrüner Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), hat mit seinen Vorschlägen zum „verpflichtenden sozialen Jahr“ für Rentnerinnen und Rentner sowie dem „Boomer-Soli“ eine Welle an Diskussionen ausgelöst. Was auf den ersten Blick als visionärer Vorstoß für mehr Generationengerechtigkeit erscheinen mag, offenbart bei näherem Hinsehen ein problematisches Verhältnis zu Grundrechten, wirtschaftlicher Vernunft und gesellschaftlicher Realität.
Zunächst zum Kern: Ein soziales Pflichtjahr für Menschen, die bereits ihr Arbeitsleben abgeschlossen haben, ist ein tiefer Eingriff in die persönliche Freiheit. Das Recht, nach Jahrzehnten der Erwerbstätigkeit den Ruhestand selbstbestimmt zu gestalten, ist nicht nur sozialpolitisch anerkannt, sondern verfassungsrechtlich durch die Freiheitsrechte geschützt. Fratzschers Gedanke, Rentner könnten wie eine Reservearmee im Sozial- oder Verteidigungsbereich eingesetzt werden, mag theoretisch nach Entlastung klingen, in der Praxis aber grenzt er an bevormundenden Zwangsstaat. Die Alten sind keine ungenutzte Ressource, sondern Menschen, die ihre Lebensleistung erbracht haben.
Hinzu kommt die soziale Schieflage: Ein Pflichtjahr würde alle gleich treffen – die Akademikerin mit leichter Erwerbsbiografie ebenso wie den Maurer, der mit 67 gesundheitlich am Limit ist. Von „Solidarität“ kann hier keine Rede sein, vielmehr wäre es eine zusätzliche Last für jene, die bereits überdurchschnittlich viel körperlich gearbeitet haben. Statt Generationengerechtigkeit droht so eine neue Form der sozialen Ungerechtigkeit.
Auch der „Boomer-Soli“ wirft schwerwiegende Fragen auf. Dass Menschen mit hohen Alterseinkünften stärker zur Kasse gebeten werden sollen, klingt populär. Doch ökonomisch birgt es die Gefahr einer Doppelbelastung: Wer über Jahrzehnte Steuern und Sozialbeiträge gezahlt hat, wird im Alter erneut fiskalisch bestraft. Damit untergräbt man das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Sozialordnung. Wer spart und vorsorgt, wird de facto sanktioniert – eine fatale Botschaft in einem Land, das ohnehin unter mangelnder privater Vorsorge leidet.
Besonders irritierend ist, dass Fratzscher die ältere Generation pauschal als selbstbezogen, ignorant und veränderungsunwillig abqualifiziert. Damit spaltet er mehr, als er einen neuen Generationenvertrag stiftet. Gesellschaftliche Solidarität entsteht nicht durch moralische Abwertung oder staatlichen Zwang, sondern durch Anreiz, Anerkennung und den freiwilligen Willen, zum Gemeinwesen beizutragen.
Die eigentliche Baustelle wird durch Fratzschers Vorschläge verschleiert: Die Herausforderungen im Rentensystem resultieren nicht allein aus dem demografischen Wandel, sondern auch aus politischem Versagen in anderen Bereichen. Deutschland hat in den vergangenen Jahren Millionen junge Migranten aufgenommen, von denen ein erheblicher Teil bis heute nicht in den Arbeitsmarkt integriert ist. Anstatt Rentner zwangsweise in Pflichtdienste zu schicken, wäre es konsequenter, hier Arbeitsbereitschaft und Qualifizierung einzufordern. Wer Teil des Sozialstaates sein will, muss auch Verantwortung übernehmen – sei es durch Erwerbsarbeit oder gemeinnützige Tätigkeiten.
Fazit: Fratzschers Vorschläge sind weniger Ausdruck ökonomischer Vernunft als vielmehr Symbolpolitik. Sie gefährden Freiheitsrechte, bestrafen Lebensleistung und lenken von den tatsächlichen strukturellen Problemen ab. Eine zukunftsfähige Rentenpolitik braucht keine Zwangsdienste und Sonderabgaben, sondern eine ehrliche Reformagenda: Förderung von Erwerbstätigkeit, Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt, Anreize für private Vorsorge und eine solide Haushaltsführung. Alles andere ist eine politische Nebelkerze – zulasten der Älteren und ohne nachhaltigen Nutzen für die Gesellschaft.