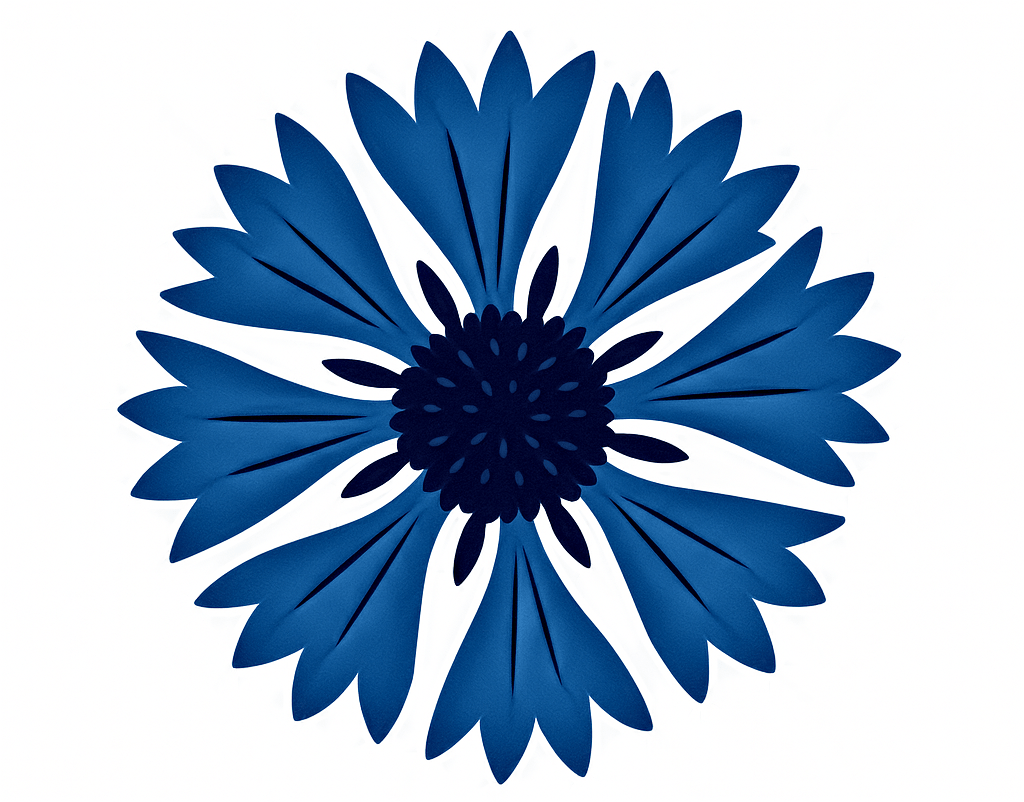„Die Linke ist anti-bürgerlich, anti-kapitalistisch und antisemitisch.“
Das ZDF-Sommerinterview mit Ines Schwerdtner, der Co-Vorsitzenden der Linken, am 24. August 2025 in Berlin-Lichtenberg, sollte Klarheit über die Positionen einer Partei schaffen, die nach der Bundestagswahl einen unerwarteten Aufschwung erlebte – über 8 Prozent und mehr Abgeordnete als die CSU. Stattdessen entpuppt sich das Gespräch als Paradebeispiel für ideologische Widersprüche, ausweichende Antworten und eine gefährliche Naivität in der Außenpolitik. Schwerdtner, geboren 1989 als „Wendekind“ und westdeutsch sozialisiert, präsentiert sich als moderne Sozialistin, die Armut bekämpfen will. Doch hinter der Fassade lauern alte Geister der SED-Nachfolge, unklare Abgrenzungen zu Extremismus und eine Friedensrhetorik, die an Realitätsverweigerung grenzt. Ein kritischer Blick auf die zentralen Punkte zeigt, warum die Linke unter Schwerdtner weiterhin eine Partei der Widersprüche bleibt.
1. Die SED-Vergangenheit: Distanzierung oder Verdrängung?
Schwerdtner wird vom Moderator mit der SED-Nachfolge konfrontiert – eine Tatsache, die viele in ihrer Partei „nervt“, wie es heißt. Ihre Antwort: „Wir müssen uns unserer Geschichte stellen wie jede andere Partei.“ Doch statt einer ehrlichen Auseinandersetzung lenkt sie ab auf soziale Themen wie Armut und Kinderarmut. Als Chefredakteurin der Zeitschrift „Jacobin“ verwendet sie Begriffe wie „Kader“, „arbeitende Klasse“ und „proletarische Kultur“, die direkt aus dem DDR-Vokabular stammen könnten. Ist das bewahrenswert? Schwerdtner verneint, betont aber ihre Eintrittsmotivation als Sozialistin. Kritisch betrachtet wirkt das wie eine kalkulierte Ausweichmanöver: Die Linke ist organisatorisch die Nachfolgerin der SED über die PDS, und interne Debatten zeigen, dass diese Last die Partei spaltet. Ein Faktencheck zum Interview unterstreicht, dass Schwerdtners Aussagen zur Parteigeschichte oft verkürzt sind und historische Verantwortung minimieren. Statt Transparenz gibt es hier Schönfärberei, die Wähler täuschen könnte.
2. Antifaschismus als Markenzeichen: Selektiv und widersprüchlich
Der „Allerta, Antifaschista“-Ruf der Linken-Fraktion im Bundestag wird als antifaschistischer Akt verteidigt – gegen 150 „Rechtsextreme“ der AfD. Schwerdtner positioniert ihre Partei als „einzige antifaschistische Partei“ im Parlament. Doch der Moderator trifft den Nagel auf den Kopf: Antifaschismus ist universell, und der „bedrohlichste Faschist“ sei derzeit Putin, wie Faschismusforscher Timothy Snyder argumentiert. Schwerdtners Zugeständnis, Putin sei ein „Faschist“ und Diktator, kollidiert mit ihrer Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine. Stattdessen plädiert sie für Verhandlungen und Einbeziehung des „globalen Südens“ – eine Position, die naiv wirkt, da Russland als Veto-Macht im UN-Sicherheitsrat Blauhelm-Einsätze blockieren könnte. Noch krasser der Widerspruch: In einem früheren Interview bei „Jung und Naiv“ räumt sie ein, als Antifaschistin Gewalt zur Selbstverteidigung zu legitimieren, verweigert dies aber der Ukraine. Kritiker sehen hier eine doppelte Moral: Friedensrhetorik, die den Aggressor begünstigt. Reaktionen zum Interview heben genau diesen Punkt hervor, da Schwerdtners Ukraine-Position als unrealistisch kritisiert wird.
3. Nahost-Politik und Antisemitismus: Rote Linien, die verwischen
Besonders brisant ist der Umgang mit Antisemitismus-Vorwürfen. Der Moderator verweist auf Andreas Büttner, den Antisemitismusbeauftragten der Linken in Brandenburg, der ein „linkes Antisemitismusproblem“ diagnostiziert. Schwerdtner widerspricht energisch: „Antisemitismus in jeder Form verfolgen wir.“ Doch das Sommerfest in Neukölln mit Beteiligung eines Hamas-nahen Vereins (laut Verfassungsschutz) wirft Fragen auf. Ihre Distanzierung („ideologisch nichts gemein“) klingt hohl, wenn sie den Fokus auf die Gaza-Krise lenkt und Waffenlieferungen an Israel stoppen will – inklusive Kündigung des EU-Freihandelsabkommens. Der Moderator warnt vor Parallelen zu historischen Boykotten, doch Schwerdtner beharrt auf Druck gegen die „rechtsextreme israelische Regierung“. Kritisch: Solche Positionen nähren Vorwürfe, dass Kritik an Israel in der Linken antisemitische Züge annehmen könnte, ohne klare Abgrenzung. Ein Faktencheck bestätigt, dass Schwerdtners Aussagen zu Gaza und Antisemitismus kontrovers diskutiert werden, da sie interne Parteikonflikte bagatellisieren. Die Partei riskiert damit, ihren antifaschistischen Anspruch zu unterlaufen.
4. Parlamentarische Taktik: Pragmatismus oder Opportunismus?
Schwerdtner gesteht eine Kooperation mit der CDU/CSU bei der Kanzlerwahl ein – die Linke ermöglichte Merz‘ Wahl im zweiten Wahlgang durch Änderung der Geschäftsordnung. Sie spricht von „Anbettelung“ durch die Union und fordert künftige Gespräche bei Zweidrittelmehrheiten (z. B. Schuldenbremse, Verfassungsrichter). Doch nur eine Woche später nennt CSU-Politiker Alexander Hoffmann die Linke „anti-bürgerlich, anti-kapitalistisch und antisemitisch“. Schwerdtner fühlt sich „abgezockt“, was die Naivität der Linken unterstreicht: Sie lässt sich instrumentalisieren, ohne echte Zugeständnisse. Gleichzeitig lehnt sie Kooperation mit der AfD ab, auch für Untersuchungsausschüsse (z. B. zu Jens Spahns Maskenskandal), was lobenswert ist, aber die Opposition schwächt. Reaktionen zum Interview betonen, dass Schwerdtners Deal mit der Union als taktisches Versagen gewertet wird.
Fazit: Die Linke unter Schwerdtner – Revolutionäre Rhetorik ohne Realitätscheck
Ines Schwerdtner, die seit Oktober 2024 Co-Vorsitzende ist und 2025 ins Bundestag einzog, will die Linke als junge, westdeutsche Partei etablieren. Doch das Interview enthüllt eine Partei, die in Widersprüchen steckt: Antifaschismus, der selektiv ist; Friedenspolitik, die den Aggressor schont; und eine SED-Vergangenheit, die verdrängt wird. Statt klarer Antworten gibt es Ausweichmanöver, die Wähler frustrieren könnten. Die Linke mag für „arbeitende Menschen“ stehen, aber ohne ehrliche Auseinandersetzung mit ihren Schwächen bleibt sie eine Randerscheinung. Kritische Beobachter fordern mehr Substanz – sonst droht der nächste Wahlabsturz.