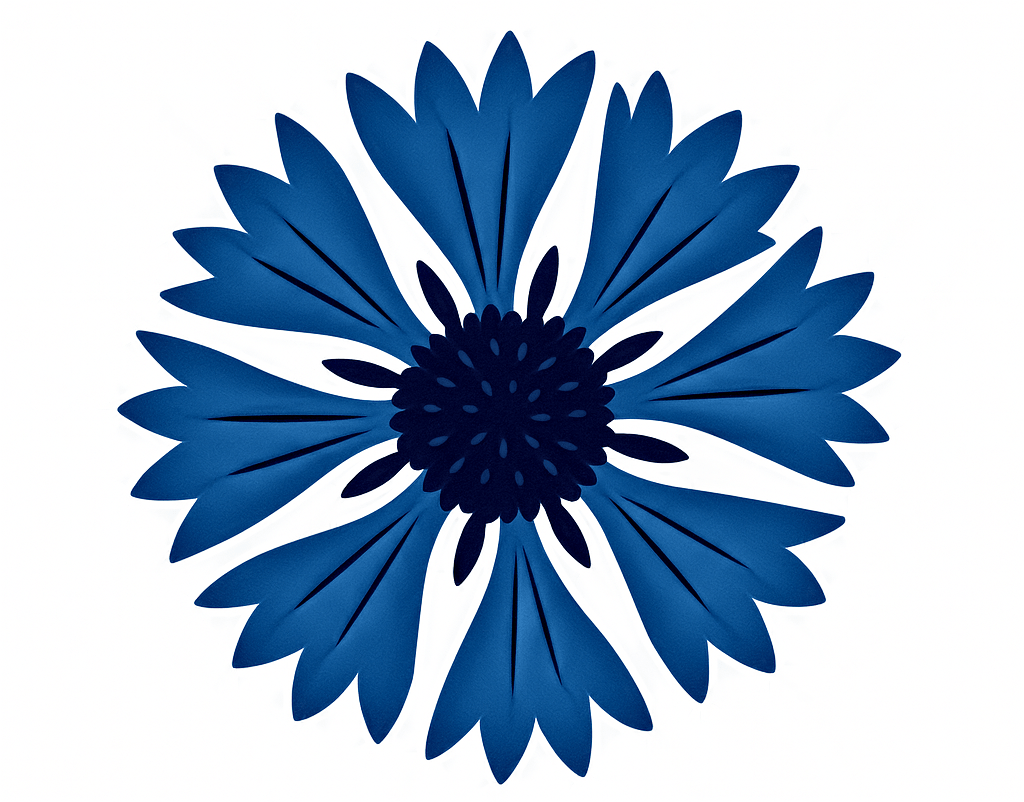Kaum ein Thema entzweit das politische Feuilleton so sehr wie die Frage, ob man mit der AfD überhaupt diskutieren dürfe. Befürworter der Gesprächsverweigerung sehen darin den letzten Damm gegen die Normalisierung einer Partei, die sie für rechtsextrem und demokratiefeindlich halten. Wer den Dialog sucht, heißt es, öffne der AfD die Türen zur politischen Bühne – und verliere damit schon im Ansatz. Gegner dieser Sichtweise verweisen dagegen auf die Grundlagen der Demokratie: Wer gewählt ist, muss sich im Diskurs messen lassen, selbst wenn seine Positionen schwer erträglich sind.
Diese Debatte ist alles andere als theoretisch. Die Tübinger Veranstaltung „Palmer vs. Frohnmaier“ hat die Frage erneut virulent gemacht. Boris Palmer, der als Oberbürgermeister in der Pflicht steht, Konflikte vor Ort auszutragen, wählte bewusst den Weg des offenen Schlagabtauschs. Er wollte nicht moralisieren, sondern argumentieren. Das Ergebnis wurde von manchen Beobachtern als mutiger Versuch gewürdigt, von anderen – wie im linksgrünen Spiegel – als „Fehler“ gebrandmarkt. Denn indem er Frohnmaier eine Bühne bot, habe Palmer ihm Legitimität verschafft.
Die Kernfrage lautet: Ist Diskurs ein Geschenk, das man dem politischen Gegner entzieht, oder ein Grundprinzip, das selbst dann gilt, wenn es unbequem ist? Wer ernst nimmt, dass Demokratie auf Rede und Gegenrede basiert, kann schwerlich verlangen, dass eine Partei, die in Landtagen und im Bundestag sitzt, in den öffentlichen Debatten völlig ignoriert wird. Schweigen ist keine inhaltliche Antwort. Vielmehr führt es dazu, dass sich AfD-Vertreter in die Opferrolle flüchten können: „Man will uns nicht hören, weil wir angeblich die falschen sind.“ Dieses Narrativ hat die Partei immer wieder erfolgreich mobilisiert.
Zweifellos birgt jedes Podium mit AfD-Vertretern Risiken. In einer Medienlandschaft, die Zuspitzung liebt, zählen oft weniger die Argumente als die Bilder. Schon die bloße Präsenz auf gleicher Höhe mit etablierten Politikern kann als Anerkennung gelesen werden. Doch daraus zu folgern, dass man den Austausch unterbinden müsse, verkennt eine zweite Gefahr: Wer AfD-Positionen nicht öffentlich konfrontiert, überlässt sie dem ungestörten Raum eigener Echokammern. Dort gewinnen sie nicht an Plausibilität, weil sie überzeugender sind, sondern weil sie unwidersprochen bleiben.
Es kommt also weniger auf das „Ob“ des Dialogs an als auf das „Wie“. Ein Gespräch, das zum bloßen Ritual verkommt, in dem AfD-Vertreter ihre Schlagworte platzieren und die Gegenseite mit moralischen Appellen verharrt, ist wertlos. Ein Schlagabtausch hingegen, in dem Zitate, Programme und Widersprüche sichtbar gemacht werden, erfüllt den Kernauftrag demokratischer Streitkultur. Er zwingt die AfD, sich zu erklären – und entlarvt dort, wo sie inhaltlich ausweicht oder ins Pauschale flüchtet. Genau dies war in Tübingen zu beobachten.
Die These „Man darf nicht mit der AfD diskutieren“ wirkt damit eher wie eine Kapitulation vor der Herausforderung. Sie vertraut darauf, dass Ignoranz stärker sei als Aufklärung. Doch eine Gesellschaft, die den Anspruch hat, durch das bessere Argument zu überzeugen, darf sich diesen Rückzug nicht leisten. Andernfalls droht sie, das Feld allein den Lautesten zu überlassen.
Das bedeutet nicht, dass jede Bühne geeignet ist. Talkshows, die Provokation in Quote verwandeln, haben der AfD tatsächlich mehr genutzt als geschadet. Doch auf kommunaler Ebene, im direkten Kontakt mit Bürgern, ist die Auseinandersetzung unvermeidbar. Dort entscheidet sich, ob demokratische Politik noch gehört wird – oder ob sich ganze Milieus dauerhaft abwenden.
Wer also sagt: „Man darf nicht mit der AfD diskutieren“, entscheidet sich für eine Strategie der Abschottung. Diese mag kurzfristig bequem erscheinen, doch sie untergräbt langfristig die Fähigkeit der Demokratie, selbstbewusst zu bestehen. Der Diskurs ist kein Geschenk, sondern eine Pflicht. Ihn der AfD zu verweigern, ist nicht Stärke, sondern Schwäche.