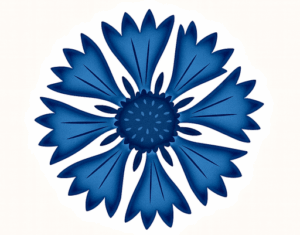Die Bilder aus London haben die politische Klasse aufgeschreckt: Hunderttausende Menschen versammelten sich, um unter dem Banner „Unite the Kingdom“ ihre Stimme zu erheben – organisiert von Tommy Robinson, einer Figur, die im britischen Establishment lange als Persona non grata galt. Was als „Familienveranstaltung“ und „Free Speech Festival“ angekündigt war, entpuppte sich als machtvolle Demonstration einer Stimmung, die von weiten Teilen der Politik seit Jahren verdrängt oder ignoriert wurde: Wut über Masseneinwanderung, Sorge um die eigene nationale Identität, Misstrauen gegen eine politische Elite, die den Kontakt zur Lebenswirklichkeit der Bürger verloren hat.
Man muss nicht jede Losung oder jede Figur auf dieser Kundgebung gutheißen, um anzuerkennen: hier artikulierte sich eine Bewegung, die den Nerv eines wachsenden Teils der Bevölkerung trifft. Robinsons Fähigkeit, weit über sein bisheriges Milieu hinaus Familien, Kleinunternehmer, Rentner und junge Patrioten zu mobilisieren, zeigt, dass es nicht um eine kleine radikale Szene geht, sondern um einen neuen Typus von Protest – breit, emotional und politisch anschlussfähig.
Der Vergleich zu früheren Großdemonstrationen in Großbritannien macht dies noch deutlicher. Die Anti-Irakkrieg-Proteste 2003 oder die Anti-Brexit-Märsche 2018/19 zogen zwar größere Massen an, doch diese standen jeweils für klassische linksliberale Themen. Dass nun eine „rechte“ Kundgebung sechsstellige Zahlen erreicht, markiert eine tektonische Verschiebung: Themen wie Migration, kulturelle Identität und Meinungsfreiheit haben eine Sprengkraft entfaltet, die den politischen Betrieb nicht länger kaltlassen kann.
Die Reaktionen aus Politik und Medien folgten dem bekannten Muster: Abwertung, Stigmatisierung, das Etikett „Festival des Hasses“. Linke Gegenproteste mobilisierten hingegen nur wenige Hundert, was nicht nur das Mobilisierungsproblem dieser Szene offenbart, sondern auch eine gesellschaftliche Stimmungslage widerspiegelt. Offenbar fühlen sich viele Bürger von den Dauerparolen der Antirassismus- und Gender-Aktivisten nicht mehr angesprochen. Stattdessen finden sie ihre Sorgen – seien sie wirtschaftlicher, kultureller oder sicherheitspolitischer Natur – auf Veranstaltungen wie „Unite the Kingdom“ wieder.
Natürlich gab es auch unschöne Szenen. Einige Demonstranten durchbrachen Polizeisperren, es kam zu Rangeleien. Doch diese Vorfälle verdecken nicht die eigentliche Botschaft: Trotz medialer Diffamierung, trotz politischer Ächtung gelang es, eine friedliche, patriotische Großversammlung auf die Beine zu stellen, deren Ton eher an ein Volksfest erinnerte als an eine Straßenschlacht. Fahnen, Gebete, Reden – all dies stand im Zeichen einer positiven Selbstvergewisserung: Wer sind wir, was bedeutet britisch zu sein, welche Werte wollen wir verteidigen?
Genau in dieser Mischung liegt die politische Sprengkraft. Denn wenn Politik und Medien diese Fragen nicht beantworten, dann wird es die Straße tun. Die Demonstranten forderten nicht nur weniger Einwanderung oder mehr Mitsprache, sondern sie setzten ein Zeichen gegen die Entfremdung von einem Establishment, das ihre Sorgen als „rechtspopulistisch“ abtut.
Das Beispiel London zeigt: Patriotische Bewegungen können – wenn sie die richtigen Themen bündeln – Massen mobilisieren, die sonst stumm bleiben. Und man darf sich keiner Illusion hingeben: auch in Deutschland ist das Potenzial vorhanden. Die Themen sind identisch – unkontrollierte Migration, Überforderung der Sozialsysteme, Kriminalität, eine Politik, die ihre Bürger belehrt statt zuhört. Bislang fehlte hierzulande eine Figur, die in der Lage ist, so unterschiedliche Milieus zusammenzuführen wie Robinson. Doch wenn die Verantwortlichen die Probleme nicht lösen, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch deutsche Straßen ähnliche Bilder zeigen.
London könnte insofern ein Menetekel sein: ein Warnsignal an Regierungen, die glauben, sie könnten die legitimen Sorgen breiter Bevölkerungsschichten ignorieren oder moralisch abwerten. Doch der politische Raum, den man nicht füllt, wird irgendwann von anderen besetzt. Die „Unite the Kingdom“-Kundgebung hat gezeigt, dass die Geduld vieler Bürger endlich ist. Wer weiterhin wegschaut, riskiert nicht nur Proteste, sondern langfristig auch einen Bruch zwischen Regierenden und Regierten.
Das Establishment täte gut daran, diese Kundgebung nicht als bloße „Randerscheinung“ zu betrachten, sondern als das, was sie ist: ein deutliches Fanal für den wachsenden Wunsch nach Selbstbestimmung, kultureller Sicherheit und politischer Teilhabe. Ignoriert man dieses Signal, wird die nächste Kundgebung noch größer – nicht nur in London.